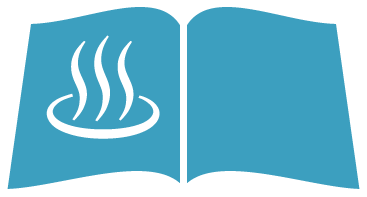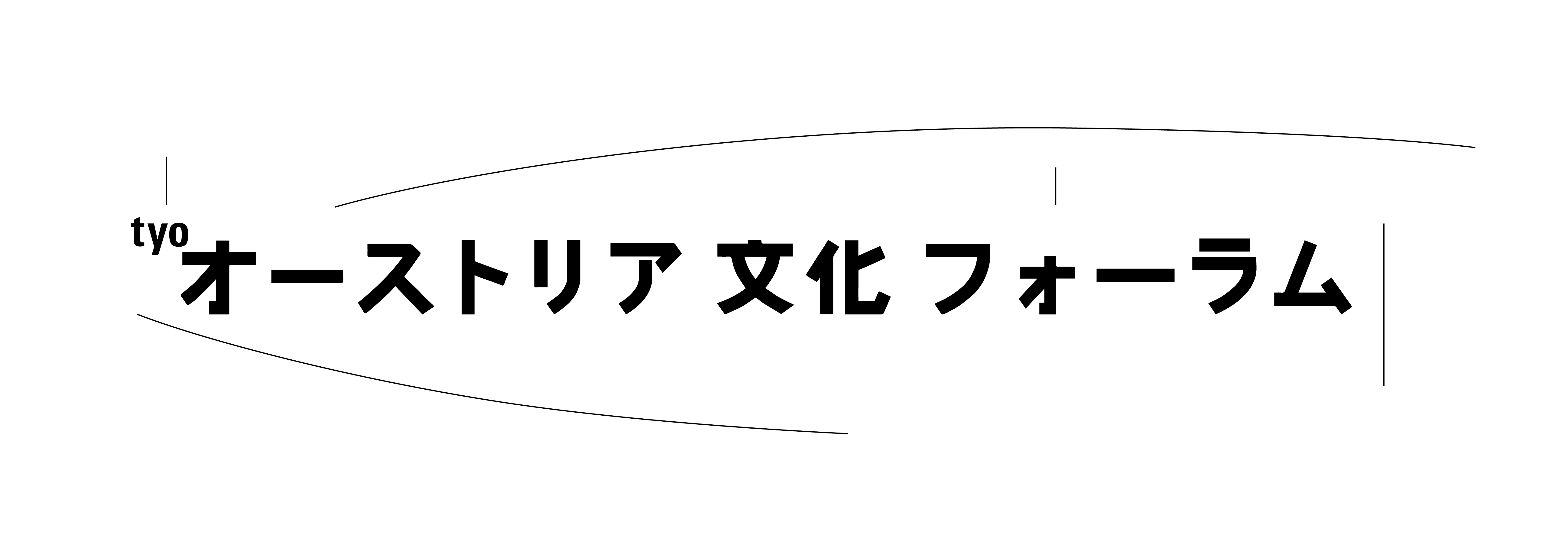Vielschichtig, abgründig, klug, sarkastisch und weise ist „Söhne und Planeten“, der erste Roman von Clemens Setz, der in meinem Vortrag einer näheren Betrachtung unterzogen werden soll. Die Hauptpersonen, fast durchweg Geistesarbeiter mit einem Hang zu Literatur und Philosophie, sprechen mit beängstigender Klugheit die drängenden Fragen unserer Zeit an und scheitern an alltäglichen Problemstellungen: geniale Dilettanten. Die in ihrer Polyphonie auch ganz neuartige Klänge enthaltende Geschichte entwickelt sich mit einer (himmels-)mechanischen Präzision und wird mit einer gehörigen Portion code-brecherischer Unverfrorenheit erzählt. Den Hintergrund dieses zwischen Franz Kafka und Thomas Pynchon angesiedelten Textpornos (mit dem Ausdruck wird nicht nur auf die Häufung an Intertextualität angespielt) bilden Muster, derer sich der Grafiker M.C. Escher in seiner Darstellung unmöglicher Formen meisterhaft zu bedienen wusste: Verzerrungen, Metamorphosen, Spiegelungen und Möbiusbänder, welche auf die Welt der (Denk-)Figuren des Buches von Setz einen ebenso prägenden Einfluss haben wie die Bahnen der Planeten. In das dicht gewobene Beziehungsgeflecht dieser menschlichen Komödie von Vätern und Söhnen, in deren Zentrum ein tragischer Todesfall steht, hat sich auch Setz mit einer Art „Potrait of the Author as a Young Man“ (James Joyce) eingeschrieben.

Das Programm als PDF