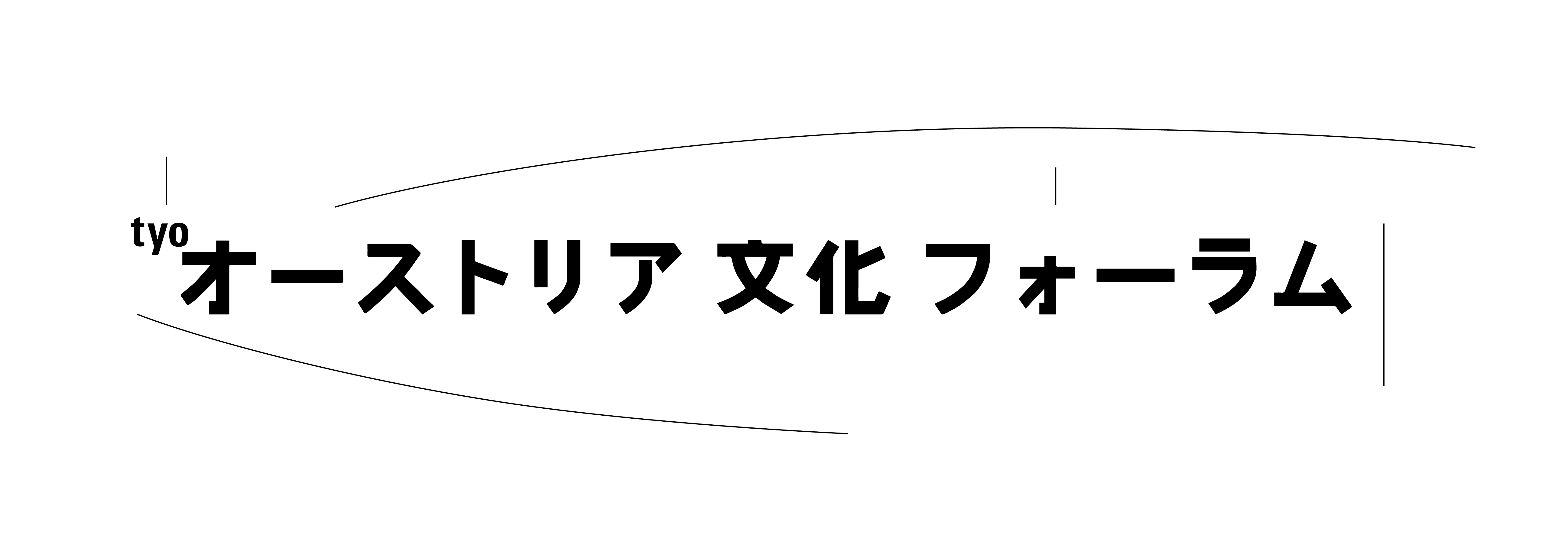1
Seit 1991 gibt Karl-Markus Gauß die im Salzburger Otto Müller Verlag erscheinende Zeitschrift Literatur und Kritik heraus. Daß die Ablösung seines Vorgängers Kurt Klinger nicht reibungslos erfolgt war, hatte ich damals mitbekommen. Die Zeitschrift hatte unter Klingers Ägide dahingedämmert, war mehr und mehr zum Organ der ihrerseits recht verschlafenen Österreichischen Gesellschaft für Literatur verkommen und hatte sich weitgehend darauf beschränkt, Aufsätze und Kongreßbeiträge von Germanisten sowie Literatur von mehr oder minder arrivierten Autoren eher konservativer Ausrichtung zu veröffentlichen. Das war jedenfalls mein Eindruck, als ich mich in jungen Jahren für Literatur zu interessieren begann. In der Bibliothek des Stiftsgymnasiums, das ich damals besuchte, war als einzige zeitgenössische Literaturzeitschrift Literatur und Kritik erhältlich, aber ich blätterte nur ein paarmal darin. Gleichzeitig fieberte ich den neuen Heften der manuskripte und des Wespennests entgegen, die mein Vater für mich abonniert hatte, ohne zu wissen, was sein Sohn da las: zwei Zeitschriften, die damals, in den siebziger Jahren, die neuen Entwicklungen in der deutschsprachigen, besonders der österreichischen Literatur spiegelten: die manuskripte mehr die sprachkünstlerische Avantgarde, das Wespennest mehr den – oft auch „neu-innerlichen“, also psychologischen – Realismus, der in Österreich an Boden gewann und bald eine Gegenströmung zur Poetik der Wiener Gruppe bildete. Als Gauß 1991 Literatur und Kritik „übernahm“, war dieser Dualismus längst aufgeweicht, wenn nicht überwunden, überholt. Gauß und seine literarischen Berater knüpften bewußt an Gerhard Fritsch an, den Mitbegründer und ersten Redakteur der Zeitschrift, der sie nur drei Jahre bis zu seinem frühen Tod 1969 leitete. Dieses Wiederanknüpfen hieß vor allem, daß man der Vielfalt der österreichischen Liteatur gerecht werden, Experimente nicht scheuen und eine Welthaltigkeit weit über die österreichischen Grenzen hinaus erreichen wollte.
Die Hintergründe des Wechsels von 1991 waren mir bis vor kurzem unbekannt gewesen. Ich war überrascht, aus einem Aufsatz von Alf Schneditz zu erfahren, daß 1989 die damalige Unterrichtsministerin Hilde Hawlicek mit der Streichung der staatlichen Subvention drohte, falls das Konzept der Zeitschrift nicht eine grundlegende Neugestaltung erfahre. Allem Anschein nach hat das Damoklesschwert seine Wirkung getan. Das Aufblühen österreichischer Literaturzeitschriften in den sechziger und verstärkt in den siebziger Jahren, der sogenannten Ära Kreisky, hängt zweifellos mit der starken Förderung der Kultur durch öffentliche Institutionen zusammen. Trotz aller Kritik und den Warnungen, die man in diesem Zusammenhang hören kann, ist dies heute noch eine österreichische Besonderheit. Die Förderung durch staatliche, städtische und regionale Stellen ermöglicht einer verhältnismäßig großen Zahl von Autoren, aber auch Zeitschriften und Kleinverlagen, das Überleben, und mit dem Blick eines Sportreporters ließe sich sagen, daß aus der Masse immer wieder Spitzenleistungen hervorstechen, die auch in Deutschland, nach dem wir aus marktstrategischen und kulturhistorischen Gründen immer noch schielen, starke Beachtung finden.
2
Ich kann und möchte hier keine quantitative Analyse von Literatur und Kritik vorlegen, sondern die These, daß Karl-Markus Gauß das getan hat, was man von einem Zeitschriftenherausgeber erwartet, mit ein paar leicht zu beobachtenden Tatsachen sowie subjektiven Erfahrungen als Leser und Beiträger dieser Zeitschrift zu belegen. Danach werde ich anknüpfend an einen programmatischen Beitrag von Klaus Zeyringer Sinn und Unsinn des Realismusbegriffs heute diskutieren und schließlich einige Probleme der Literaturkritik streifen.
Was erwartet man von einem Herausgeber? Daß er das von ihm Herausgegebene prägt. Literatur und Kritik besteht in seiner heutigen, seit 1991 im wesentlichen unveränderten Form aus fünf Teilen: 1. Kulturbriefe, 2. Lyrik, Prosa, Essays zumeist, aber nicht ausschließlich österreichischer Herkunft, 3. ein sogenanntes Dossier, 4. Buchkritiken von österreichischen oder mit dem Land eng verbundenen Autoren und 5. einem österreichischen Alphabet, in dem wenig bekannte, manchmal regelrecht vergessene Autoren der österreichischen Literaturgeschichte besprochen werden. Die Buchbesprechungen spiegeln einigermaßen vollständig die Entwicklung der österreichischen Literatur wider – das ist eine der wesentlichen Aufgaben der Zeitschrift, die von keiner anderen Publikation erfüllt wird. Die Vollständigkeit hat eine Ausnahme: Karl-Markus Gauß. Wenn ich nicht irre, wurde nie eines seiner Bücher in Literatur und Kritik besprochen. Das finde ich schade und halte ich für eine Wirklichkeitsverzerrung. Natürlich sollte ein Zeitschriftenherausgeber sein Licht nicht auf den Scheffel stellen, und noch weniger sollte er Freunderlwirtschaft treiben. Immerhin gäbe es die Möglichkeit, seine Bücher durch Außenstehende, die nicht zum engeren Kreis der Mitarbeiter zählen, besprechen zu lassen. Auch eigene literarische Beiträge druckt Gauß nicht in „seiner“ Zeitschrift ab. Mit einer Ausnahme: die zweiseitigen Herausgeberbriefe zu Beginn jedes Hefts sind nicht selten literarische Miniaturen, wie man sie auch in den Journalen von Gauß findet. Manchmal haben sie die Funktion, auf das Heft selbst hinzuweisen, in anderen Fällen besteht kein solcher oder nur ein loser Zusammenhang. Letzteres trifft auf das Editorial im Heft vom Juli 2007 zu. Hier überrascht Gauß den Leser mit der Frage, ob er die Hauptstadt Europas kenne. Nein, nicht Brüssel oder Straßburg, sondern Sejny ist gemeint, eine kleinen Stadt an der polnisch-litauischen Grenze mit gemischter Bevölkerung – Litauer, Weißrussen, ukrainer, Ruthenen, Polen, Russen – und einem regen kulturellen Leben, wo ein Theaterdirektor, Schriftsteller und Verleger namens Krzystof Czyzewski seine vielfältigen Aktivitäten pflegt. Hartnäckig, wie er ist, sieht Gauß hier, in diesem Laboratorium des Minoritären, die Zukunft Europas – wenn es überhaupt eine Zukunft hat, denn auch apokalyptische Visionen vom Einheitsbrei der Kongreß- und Geschäftseuropäer sind Gauß nicht fremd.
Der Hinweis auf Sejny verfolgt ein ähnliches Anliegen wie das Buch Die sterbenden Europäer, wo Gauß seine Reisen zu sprachlich-ethnisch-kulturellen Minderheiten in ganz verschiedenen Gegenden Europas beschreibt. Sein Editorial im letzten Heft von Literatur und Kritik steht in lockerem Zusammenhang zum Dossier, das seinerseits „locker geknüpft“ ist und den Titel „Passagen“ trägt. Darin sind Texte verschiedenen Genres versammelt, ihre Autoren sind zumeist Migranten, Flüchtlinge, sie stammen aus Kuba, Weißrußand, Moldawien, der Slowakei und der Schweiz. Ein Essay ist einer Engländerin gewidmet, die im 18. Jahrhundert, als dies alles andere als selbstverständlich war, Briefe über ihre Erfahrungen im Orient, vor allem in der Türkei, veröffentlichte. Die lockere Verknüpfung solcher Zeitschriftenbauteile halte ich für eine der Stärken von Literatur und Kritik. Auf der einen Seite gibt es streng thematisch gebundene Dossieers, zum Beispiel albanische oder baskische Lyrik oder „kleine Geschichten aus der großen Stadt“ (Mexiko), auf der anderen Seite eben Konvolute, über denen jeweils „Passagen“ als Titel stehen könnte. Manchmal fehlt auch der Abschnitt Dossier oder das österreichische Alphabet zugunsten des Hauptteils, der dann umfangreicher ist und beispielsweise junge, wenig bekannte österreichische Autoren vorstellt, von denen manche, nicht alle, eines Tages bekannt sein werden. Kathrin Röggla, die aus Salzburg stammende Autorin, hat in noch mädchenhaftem Alter hier ihre ersten Texte vorgestellt.
Ein eigener Fall ist die Rubrik mit dem altertümlichen, neue Leser (absichtlich?) in die Irre führenden Titel „Kulturbriefe“. Wenn ich die Entwicklung seit 1991 recht überschaue, waren sie zunächst als Berichte aus unterschiedlichen Städten und Weltgegenden gedacht. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Serie von Paris-Texten von Franziska Augstein, die damals Korrespondentin einer großen deutschen Zeitung war. Ich selbst habe Kulturbriefe aus La Plata, Szeged, Tirgu Mures, Rom und Hong Kong, über Japan, Diego Maradona und, zusammen mit einem argentinischen Kollegen, über Bill Gates verfaßt. Im Lauf der Jahre sind zu den Reise- und Auslandsberichten auch Nachrufe, Albumblätter und zeitkritische Essays getreten. Im letzten Heft von Literatur und Kritik findet sich ein aufschlußreicher Text eines in Antwerpen tätigen Germanisten über Josefine Mutzenbacher, den Roman einer Wiener Hure – ein Aufsatz, der ebensogut im Hauptteil der Zeitschrift hätte veröffentlicht werden können. Die Journale von Gauß bestehen aus denselben Ingredienzien: Reisebericht, zeitkritische Reflexion, Kommentare zur Medienwelt, literaturgeschichtliche Streifzüge, Autorenporträts oft in Form von Nachrufen, autobiographische Fragmente und vielleicht, wer weiß, auch ein bißchen Fiktion. Die „Kulturbriefe“, die so viel zur geistigen Öffnung und Durchlüftung der Zeitschrift beigetragen haben, spiegeln in der Gesamtansicht am stärksten das eigene literarische Tun des Herausgebers. Die Neugier geht dabei, bedingt durch österreichische Kulturtraditionen – und bei Gauß’ eigenen Schriften auch durch die Herkunft seiner Familie – zuerst in osteuropäische, dann aber auch in alle anderen Himmelsrichtungen.
Mehr oder weniger offen, zuweilen auch unterschwellig, wurde und wird der Wechsel von 1991 als politischer Vorgang hingestellt, zu allererst von Kurt Klinger selbst. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, obwohl die Unterstellung, es habe sich um einen Putsch mit irgendwelchen Hintergedanken gehandelt, unsinnig ist. Bei vielen Kulturbriefverfassern glaube ich eine Tendenz zu bemerken, immer wieder auf politische und soziale Aspekte des von ihnen Beschriebenen hinzuweisen. Ob das der Linie der Zeitschrift entspricht oder einfach den Interessen und Vorlieben ihrer Autoren, ist schwer zu sagen; wahrscheinlich kommt beides zusammen. Und tatsächlich ist 1991 eine Wende von einem doch recht bornierten Betrieb hin zu einer Weltoffenheit eingetreten, die eine Vielzahl von Blickweisen, politischen und nicht-politischen, zuläßt. Drei der im letzten Heft vertretenen Passagen-Autoren haben zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer persönlichen Geschichte ein kommunistisches bzw. postkommunistisches Land verlassen, und die Erfahrungen mit dem Totalitarismus unterschiedlicher Ausformung spielen in ihren Texten eine je eigene Rolle (auch, wie mir scheint, in Alhierd Bacharevic‘ Geschichte über einen Stotterer, der mit seinem greisen Großvater zusammenlebt). Andererseits kommen in Literatur und Kritik auch Autoren zu Wort, die an sozialistischen Idealen festhalten, Erich Hackl zum Beispiel, der, wenn ich nicht irre, noch jedes machthabende Regime, auch das castristische, seiner Kritik unterzogen hat. Festzuhalten bleibt jedoch, daß Literatur und Kritik überhaupt Fragen nach politischen Weltsichten aufwirft. An einer Zeitschrift wie den manuskripten oder auch der kolik, einer Abspaltung des Wespennests, würde diese Fragestellung vorbeizielen.
In Zu früh, zu spät steht eine mehrseitige Passage über Kurt Klinger; einer von nicht wenigen Nachrufen, die Gaußens Journale enthalten. (Nachrufe und Attacken ist der Untertitel eines früheren Buchs von Gauß, der das Spiel von Rückblick und Angriff, von Rettungsversuch und gegenwartsbezogener Polemik charakterisiert.) Gauß hütet sich vor „falscher Versöhnung“ mit dem, der ihn als Konkurrenten sah; sein Nachruf ist dennoch mild und ausgewogen und einmal sogar berührend, wenn der biographische Abriß damit beginnt, daß Klingers Leben unter einem „düsteren Stern“ gestanden habe, aber mit einer Art glücklichem Nachsommer ausgeklungen sei, als der in die Jahre gekommene Klassik- und Italienliebhaber in einer Wohnung in Rom lebte – „zusammen mit einem Mann“, wie Gauß dezent bemerkt. Gauß zeigt sich Klinger gegenüber sogar dankbar, denn immerhin hat er einige seiner frühen Texte in Literatur und Kritik veröffentlicht. An Klingers Lyrik, die Gauß in Rezensionen wohlwollend besprach, gefielen ihm „der rauhe, doch kunstvoll beherrschte Ton“, und die Bildung des Älteren findet durchaus die Bewunderung des Jüngeren. Auch die Tätigkeit Klingers als Redakteur von Literatur und Kritik verdammt Gauß nicht in Bausch und Bogen; allerdings habe der Zeitschrift unter Klingers Leitung „ein Konzept gefehlt, das über die beliebige Abfolge von Texten hinausgegangen wäre, und was in ihr kaum wehte“, fügt Gauß hinzu, „war der kritische Geist, für den Klinger als Essayist selber eingestanden war.“ Er meint, daß Klinger persönlich und literarisch gar nichts gegen ihn gehabt habe, und wägt am Ende ab, ob Versöhnung nicht doch der höflichen Distanz vorzuziehen gewesen wäre. Die kaum vorhandene persönliche Kommunikation zwischen beiden habe sie „vor der falschen Versöhnung bewahrt, aber auch einen echten Friedensschluß verhindert, und der falsche Samariter in mir fragt zu spät“ – daß Gauß die Frage wichtig ist, zeigt die Präsenz dieser Wortfügung im Titel des Buchs –, „ob es nicht an mir, dem Jüngeren, der ich im Streit um Literatur und Kritik über ihn obsiegt habe, gewesen wäre, diese Begegnung jenseits des Resentiments und der Kränkungen herbeizuführen.“
3
Eines der Prinzipien von Gaußens Herausgeberschaft besteht darin, keine literaturwissenschaftlichen Beiträge abzudrucken, wohl aber Essays zur Literatur, deren Verfasser nicht selten Germanisten sind. Die Trennlinie zwischen beiden Textsorten ist unsicher, mitunter scheint es nur darum zu gehen, ob ein Text auf Fußnoten daherkommt oder nicht. Als Autor und ausgebildeter Germanist, der sich fragt, ob es so etwas überhaupt geben kann: Literaturwissenschaft, finde ich solche Grenzverwischungen nicht nur sympathisch, sondern notwendig. Das Juli-Heft 2007 enthält einen Essay des Germanisten Klaus Zeyringer; im Rezensionsteil desselben Hefts wird sein letztes Buch besprochen, das, wie der Rezensent versichert, „in Österreich Furore gemacht“ hat. In seinem Essay behauptet Zeyringer, es sei „eine neue Runde in der Realismusdebatte“ eingeläutet. Er bezieht sich auf ein in Frankreich stattfindendes Festival, das er offenbar – die Reise von Angers nach Saint-Malo ist nicht weit – besucht hat. Bei diesem Festival wurde ein literarisches Manifest von vierundvierzig Schriftstellern vorgestellt, die alle französisch schreiben, aber nicht aus Frankreich stammen. Der Begriff, um den sich das in Le Monde veröffentlichte Manifest dreht, ist littérature-monde; er klingt wie ein Echo jener „Weltliteratur“, die Johann Wolfgang Goethe vor mehr als zweihundert Jahren forderte. In französischem Kontext klingt das Wort aber auch nach Globalisierung, die auf französisch mondialisation heißt. Die vierundvierzig Manifestunterzeichner wollen die frankophone Literatur auf das in erster Linie technologisch bedingte soziokulturelle Phänomen rasch fortschreitender Globalisierung ein- und umstellen. Wenn ich Zeyringer richtig verstehe, geht es ihnen darum, den Vorsprung der englischsprachigen Literatur aufzuholen, deren globalisierungstaugliche Erzählformen – es geht bei allen diesen Diskussionen ausschließlich ums Geschichtenerzählen, nicht um Sprachkunst, nicht um poetologische Fragen – seit Jahrzehnten den Markt dominieren.
In diesem Zusammenhang bricht Zeyringer eine Lanze für erfolgreiche deutschsprachige Autoren wie Daniel Kehlmann (in Zeitungsrezensionen auch für Michael Köhlmeier oder Robert Menasse, der besonders intensiv an Erfolgsstrategien arbeitet). Allerdings scheint mir, daß Zeyringer ein von ihm selbst konstruiertes Phantom geißelt, wenn er „die Klagen der ‚Experimentellen‘, daß alles, was sich gut verkaufe, dem unguten ‚Kommerz‘ ergeben, also schlecht sein müsse“. Wer wollte ernsthaft behaupten, daß alles Erfolgreiche schlecht sein muß? Ich nicht, und ich zähle mich weder zu den Experimentellen noch zu den Realisten. Allerdings gilt der Umkehrschluß ebensowenig. Was erfolgreich ist, muß deshalb nicht gut sein. Leider kommt man nicht darum herum, sich jedesmal von neuem Gedanken zu machen machen und sich ein Urteil zu bilden, ob man etwas gut oder ungut finden will oder nicht. Wer noch weiter avanciert ist, wird sich Gedanken machen, ob nicht der immer stärker gewordene Druck des Buchmarkts und der sogenannten public relations auf das Schreiben der Autoren zurückwirkt. Aber das steht auf einem anderen, nicht auf Zeyringers Blatt, wiewohl er in seinem letzten Buch in gut literatursoziologischer Manier Machtverhältnisse im Literaturbetrieb beschreibt.
Was hat das alles mit Realismus zu tun? Nicht viel. Eher scheint es die Absicht Zeyringers und der vierundvierzig Weltliteraten zu sein, spannende Geschichten zu erzählen bzw. zu lesen. Dazu muß man allerdings kein Realist sein. Und andererseits tun zahllose deutsche und französische Autoren seit Jahren nichts anderes, als dem Geschichtenerzählimperativ hinterherzuschreiben. Daß die deutschen (und französischen) Autoren im Unterschied zu den angelsächsischen keine Geschichten erzählen können, ist längst ein Stereotyp, ja, ein Vorurteil der deutschen Literaturkritik. Will man wirklich nicht zur Kenntnis nehmen, daß ein Ingo Schulze auf angelsächsischen Spuren inzwischen eine ganze Reihe von „sehr gut erzählten“ (wie Reich-Ranicki sagen würde) Büchern herausgebracht hat? Oder in Frankreich Michel Houellebecq, in dessen erstem Roman sich eine ernstzunehmende neue, fast soziologistisch zu nennende Realismustheorie findet? Und allein im kleinen Österreich diese vier von Zeyringer gern genannten Namen: Kehlmann, Glavinic, Menasse, Köhlmeier? Da wird doch erzählt, was das Zeug hält? Und diese Autoren, sind sie nicht allesamt recht erfolgreich? Und wenn sie dennoch keinen Zugang zum englischsprachigen Markt finden, dann liegt das vielleicht doch nicht sosehr an der Unfähigkeit der Autoren als an den Gesetzen, den Launen, der Arroganz des globalen, das heißt englischsprachigen Markts. Wozu braucht die englischsprachige Weltbevölkerung deutsche Erzähler, wenn sie eh genug amerikanische, englische usw. hat? Außerdem: Übersetzungen kommen teurer als Veröffentlichungen in der Originalsprache.
Aber was hat das alles mit Realismus zu tun? Nichts. Auf eine Beantwortung der Frage, wie die Welt ins Buch kommt, zielt weder Zeyringers Essay noch das Manifest der vierundvierzig frankophonen Weltliteraten. Übrigens auch nicht Robert Menasse in seiner globalisierungskritischen Poetikvorlesung, wo er die bedenkliche Realismus-Utopie einer „Welt, in der die Begriffe und die Realität endlich identisch sind“, formuliert und in marxistischem Tonfall hinzufügt, um zu dieser schönen neuen Welt zu gelangen, müsse man die alte „zerstören“. Diesseits solcher Utopien bleibt die Beantwortung der Frage, wie die Welt ins Buch komme, die Schwierigkeit und Kunst poetologischen Nachdenkens. Wer sich dieser Aufgabe stellt, wird zwangsläufig irgendwann mit den Grenzen der Erkenntnis und sprachlicher Abbildung von Außersprachlichem stoßen. Gewiß, in Österreich hat der Zweifel an den Möglichkeiten der Sprache spätestens seit Hofmannsthals Brief und Wittgensteins Tractatus Tradition. Aber zahlreiche Autoren haben sich von Zweifeln freigemacht oder freigehalten und frisch-fröhlich oder auch dunkel erzählt, beschrieben, erfunden, ausgedrückt, was sie berührte. Zum Beispiel Franzobel, der Spracherotiker auf den Spuren von Nestroy und Herzmanovsky-Orlando. Mir scheint das Gegensatzpaar, das in den Reflexionen von Karl-Markus Gauß immer wieder auftaucht, viel fruchtbarer zu sein: Sprachkritik und Spracherotik. Fruchtbarer als die Lancierung von Realismusdebatten, die sich de facto schon in den siebziger Jahren erschöpft haben. Sprachzweifler und Spracherotiker, zuweilen in Personalunion. Gauß selbst ist ein Spracherotiker, fernab vom sprachlichen Experiment. Ähnlich wie W. G. Sebald genießt er beim Schreiben (und ich beim Lesen) die Verschlingungen der deutschen Syntax, den Rhythmus ausschwingender, am Ende aber zum Ausgangspunkt zurückkehrender Satzperioden, das gediegene, geschichtsträchtige und nuancenreiche, fallweise auch das scharfe und unterscheidende Vokabular. Wir können mit Sprache der Wirklichkeit gerecht werden: selbstverständlich, dazu ist sie schließlich da, aus diesem Bedürfnis hat sie sich über die Jahrhunderte hinweg verfeinert – und wird gleichzeitig immer wieder bedroht, so daß der Gebrauch von gediegener, nicht nur an umgangssprachlichen Praktiken klebender, nicht nur mit sich selbst spielender Sprache auch zur Verteidigung der Wirklichkeit, ihrer Nuancen und der Erkenntnis ihrer Nuancen, ihrer feinen Unterschiede dient. Von der Sprachkritik über die Spracherotik zur Verteidigung der Sprache gegen eine zunehmend von massenmedialen Bildern dominierte, spielsüchtige Gesellschaft. Gegen Verkürzungen, Denkfaulheit, Stereotype. Dafür steht, neben anderen Autoren unterschiedlicher Provenienz, Karl-Markus Gauß.
Also doch ein Plädoyer für Realismus? Daniel Kehlmann hat einmal erzählt, er habe vor, sämtliche Bücher des peruanischen Romanciers Mario Vargas-Llosa zu lesen, weil er die Machart seiner Romane für vobildlich halte. Inzwischen wird er wohl beim letzten Buch von Vargas Llosa angekommen sein, das kräftig drauflos erzählt, und zwar von einem „bösen Mädchen“, das in jungen Jahren das triste Peru verläßt, um die Welt zu erobern. Die Geschichte führt nach Paris und in andere europäische Städte und schließlich nach Japan, das freilich besonders klischeehaft beschrieben wird. Man merkt diesem Roman sein Bemühen um Globalität an; der Weg der beiden Protagonisten soll buchstäblich um die ganze Welt führen. Die Geschichten lassen sich flüssig lesen, man wird bei der Lektüre unterhalten, und trotzdem: ein überflüssiges Buch, das mir keinerlei Erkenntnis verschafft hat. Der Gerechtigkeit halber ist zu sagen, daß Vargas Llosa einige außergewöhnliche Romane geschrieben hat, darunter Das grüne Haus und das monumentale Gespräch in der Kathedrale. Vargas Llosa war einer der vier Romanciers, die unter der Marke eines lateinamerikanischen „Booms“ weltberühmt wurden. Daß Kehlmann ihnen seine Reverenz erweist, indem er in Die Vermessung der Welt ein Quartett mit den Vornamen Mario, Julio, Gabriel und Carlos vorkommen läßt – gut, eine nette Geste. Drei der Genannten zehren heute von ihrem frühen Ruhm, sie bestehen als Denkmäler jener Autoren, die sie einmal waren. Der vierte ist schon lange tot: literaturhistorisch betrachtet vielleicht die bessere Option. Die verfeindeten Freunde García Márquez und Vargas Llosa hat der aus Chile stammende Roberto Bolaño in einem seiner letzten Bücher als „greises Macho-Duett“ bezeichnet. Der sogenannte magische Realismus ist längst tot; wer unbedingt einen neuen Realismus braucht, kann ihn bei Bolaño finden. Er hat übrigens, aus dem Off heraus, also vom Rand der (Literatur-)Gesellschaft, mit der er sich nie verbrüdern wollte, den halb ironischen Begriff des „Infrarealismus“ geprägt. Natürlich wollte auch Bolaño Leser für seine Bücher, aber nicht um jeden Preis. Sein erster und letzter Gesichtspunkt war trotz allem die Literatur, und in der Literatur wiederum das Poetische. Daß er nach vielen durchkämpften Jahren doch noch Erfolg hat, ist ein Glück (das er nicht mehr genießen kann). Inzwischen werden seine Bücher, wie mir neulich Ann Waldman erzählte, sogar in den USA übersetzt. Zeyringer aber betet lieber das Kehlmann-Geplauder von den „Erzählern Südamerikas“ nach, denen „die größte literarische Revolution der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts“ gelungen sei. Abgesehen davon, daß Carlos Fuentes kein Südamerikaner ist und die Erzähltechniken der Autoren des Booms aus Nordamerika übernommen wurden, von William Faulkner (Márquez & Co. haben daraus nie ein Geheimnis gemacht), sind eben diese Techniken längst im Mainstream des Erzählens aufgegangen, besonders im filmischen Erzählen, Marke Hollywood. Diese Revolution ist vorbei, wie alle anderen auch.
4
Nach meinem Verständnis ist eine Rezension, die diesen Namen verdient, ein kleines Kunstwerk. Ein kleines zumeist, weil der Raum und oft auch die Zeit knapp sind. Auf wenigen Zeilen soll man einem Buch gerecht werden, in dem oft ein halbes Dichterleben steckt. Spontanes Schreiben ohne langwieriges Nachdenken, ohne umfangreiche Recherchen. Die Nötigung zum konzisen Ausdruck kann den Rezensenten zum Gebrauch rhetorischer Formeln verführen, und wer wäre dagegen gefeit; sie kann aber auch unverhoffte Einfälle, überraschende Wendungen, kühne Verknappungen bewirken. Die Lektüre des Rezensionsteils von Literatur und Kritik ist daher vergnüglich, erkenntnisgebend, zuweilen ärgerlich – auch der Ärger kann bekanntlich Quelle des Vergnügens sein. In einem seiner Journale gibt Gauß ein kurzes Porträt eines besonders eifrigen Rezensenten: Helmut Gollner, Mitglied des Beirats von Literatur und Kritik. Gollner eignen vom Aussterben bedrohte Tugenden: Freundlichkeit, Menschenliebe, selbstlose Neugier, Bescheidenheit. Er führt ein Lektüretagebuch, das zahllose Bände umfaßt, weil er, so berichtet Gauß, ein schwaches Gedächtnis habe. In einer sehr eingehenden Besprechung des Erstlingsromans von Georg Petz steht der wunderbare Satz: „Der junge Autor möge dem (alten) Rezensenten verzeihen, wenn ihm schon jetzt aus Ärger und Empörung, die bei der Lektüre ständig wuchsen, einige Schärfe in die Sätze gerät. Es kommt noch schlimmer.“ Wer selbst Rezensionen schreibt, weiß, wie heikel es ist, Erstlingsbücher oder Bücher von sehr jungen Autoren zu kritisieren. Man will nicht aufgrund eines einzigen Werks eine Karriere behindern, die noch gar nicht richtig begonnen hat. Gollner nimmt sich in dem hier zitierten Text kein Blatt vor den Mund, und seine Argumente überzeugen. Er bricht in aller Freundlichkeit mit der Gewohnheit wohlwollenden – das heißt faktisch aber oft auch gönnerhaft-herablassenden – Schreibens über Erstlinge und versucht, der Wahrheit die Ehre zu geben. Möglicherweise tut ein Verleger einem jungen Autor nichts gutes, wenn er ein noch nicht ausgereiftes, nicht wirklich überzeugendes Werk veröffentlicht. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel taucht in Gollners Rezension die Frage auf: „Herr Pils, lesen Sie auch, was Sie verlegen?“ Eine gute Frage, vor allem in Österreich mit seiner (im Prinzip lobenswerten) Verlagsförderung.
Einen anderen, ebenfalls interessanten Fall haben wir in der Besprechung von Peter Handkes Erzählung Kali durch Franz Haas, der wie Gollner regelmäßig für Literatur und Kritik schreibt, ein Kritiker von hoher Reputation ist. Haas drückt mit seinem Urteil herum. Er lobt die Sprache und einzelne Bilder Handkes, meint aber, daß solche Wahrnehmungsprosa den Mangel an inhaltlich-narrativem Gehalt nicht ganz wettmachen könne. Jedenfalls für den, der nicht an den heiligen Handke glaubt, sprich: der nicht zur eingeschworenen Lesergemeinde gehört. Gehört Haas nun dazu? Auch das wird nicht klar. Vielleicht will er ja nur die Handke-Fangemeinde nicht verkraulen. „So kommen durch Peter Handkes Zauberblick und Wortbalance meist sogar die verwunderlichsten schiefen Seiten wieder ins Lot.“ Meist, nicht immer. Einiges an der Kali-Erzählung ist und bleibt schief. Ich glaube aus eigener Erfahrung zu wissen, wie schwierig es ist, ein abwägendes, am Ende vielleicht ausgewogenes Urteil zu formulieren. Viel schwieriger als Lob und Verriß. Oft aber auch fehl am Platz, weil das Abwägen pingelig werden und den Blick aufs Ganze vernebeln kann. Tatsächlich kommt es vor, daß wir dasselbe Buch, wenn wir es später noch einmal lesen, anders lesen als beim ersten Mal. Vielleicht sind unsere Empfindungen sogar gegensätzlich. In uns stecken mehrere Leser, wir sind abhängig von Stimmungen und Launen, und wir verändern uns im Lauf der Zeit. „Es ist letztlich eine individuelle Frage, ob man Handkes Sprache zu glauben und dem Inhalt solcher Vorwintermärchen zu trauen vermag.“ Ist Mißtrauen angebracht? Kritische Lektüre? Unterwerfung unter den Text, die erst den vollen Genuß erlaubt? Über seine Individualität verrät uns der Rezensent nichts.
Zuletzt sei ein anderer bekannter und eifriger Literaturkritiker erwähnt, der Wiener Germanistikprofessor Wendelin Schmidt-Dengler. Es geht in seiner Besprechung – ebenfalls in Heft 415/416 von Literatur und Kritik – um Kurzessays von Cornelius Hell. Aus Schmidt-Denglers Text springt der zweimalige Gebrauch des Beiworts „leicht“ ins Auge: „Es ist schwer, dieses Buch mit seinem leicht provokanten Titel zu charakterisieren“, und: „Immer ist diesen Texten ein leichtes Ferment des Aufbegehrens beigemengt…“ Die Feingeister in Ehren, aber derlei Vorsicht weckt in mir den Wunsch nach richtig provokanten Titeln und starken Fermenten des Aufbegehrens, kurz: nach Heavy Metal in der Literatur. Sogar ein leicht originelles Wortspiel erlaubt sich Schmidt-Dengler: Aus seiner Antipathie gegen Gottfried Benn mache „Hell keinen Hehl“. Hell ist im selben Heft selbst mit einer Rezension vertreten. Darin attestiert er Michael Stavaric, einem jungen Autor, der sich offenbar besser in Szene zu setzen versteht als Georg Petz: „Der kann was, der Stavaric! Und er weiß es auch, haben doch die Kritiken seines Prosaerstlings stillborn im Vorjahr alle Register der Superlative gezogen.“ Erfolgreiche (?) Literatur kann nicht ungut sein, also beschließt Hell, sie geschmackig zu finden: „Prosa vom Feinsten wird hier aufgetischt“. Ich finde die Selbstverständlichkeit bemerkenswert, mit der hier davon ausgegangen wird, daß Autoren alle Rezensionen ihrer Bücher lesen, als seien diese an sie persönlich adressiert. Aber wahrscheinlich hat Hell recht, es geht den Rezensenten eher um die Begütigung oder Provokation eines Autors als um das Verfassen einer sprachkünstlerischen Miniatur, die einem Text gerecht zu werden versucht. Der Leser der Leseberichte wird folgerichtig zum Zuschauer, der sich am Geplänkel zwischen dem durch sein Buch vertretenen Autor und dem Kritiker ergötzen darf.
Erwähnte Literatur:
Literatur und Kritik, besonders Heft 415/416 (2007)
Roberto Bolaño: Der Cthulhu-Mythos, in: R. B.: Der unerträgliche Gaucho. München 2006
Karl-Markus Gauß: Ins unentdeckte Österreich. Nachrufe und Attacken. Wien 1998
Ders.: Die sterbenden Europäer. Unterwegs zu den Sepharden von Sarajewo, Gottscheer Deutschen, Arbereshe, Sorben und Aromunen. Wien 2001
Ders.: Mit mir, ohne dich. Ein Journal. Wien 2002
Ders.: Zu früh, zu spät. Zwei Jahre. Wien 2007
Ders.: Die Vermessung der Welt. Reinbek 2005-
Michel Houellebecq: Ausweitung der Kampfzone. Berlin 1999
Daniel Kehlmann: Diese sehr ernsten Scherze. Poetikvorlesungen. Göttingen 2007
Robert Menasse: Die Zerstörung der Welt als Wille und Vorstellung. Frankfurter Poetikvorlesungen. Frankfurt am Main 2006
Alf Schneditz: Die sechziger und siebziger Jahre im Spiegel von „Literatur und Kritik“ (unveröffentlichter Beitrag zu einem Symposion in Saarbrücken im Jahr 2000)
Mario Vargas Llosa: Das böse Mädchen. Frankfurt am Main 2006

| Freitag, 9. November 2007 | |
| 18:00 | Eröffnung und Abendessen |
| 20:00 | Karl-Markus Gauß im Gespräch mit Leopold Federmair. Eine Einführung in Dialogform |
| 21:00 | Lesung Karl-Markus Gauß |
| Samstag, 10. November 2007 | |
| 09:30 | Die Reiseliteratur von Karl-Markus Gauß Yasuko Nunokawa |
| 10:15 | Oral History als Methode |
| 11:00 | Lesung Karl-Markus Gauß |
| 11:30 | Literatur ist Kritik ist Literatur Leopold Federmair |
| 12:15 | Mittagessen |
| 15:00 | Lesung und Werkstattgespräch mit dem Autor |
| 18:00 | Abendessen |
| 20:00 | Nationalität und Transnationalität: Karl-Markus Gauß und Stefan Zweig in Essays und Reportagen |
| 20:30 | Örtlichkeiten in „Zu früh, zu spät“ |
| Sonntag, 11. November 2007 | |
| 09:30 | Anmerkungen zu Gauß-Lektüren |
| 10:30 | „Die Hundeesser von Svinia“: Vorstellung und Diskussion |
| 11:45 | Lesung Karl-Markus Gauß |
| 12:15 | Seminarende |