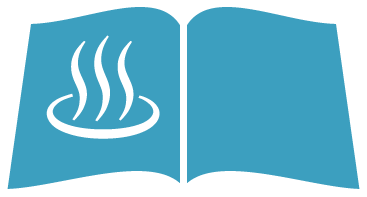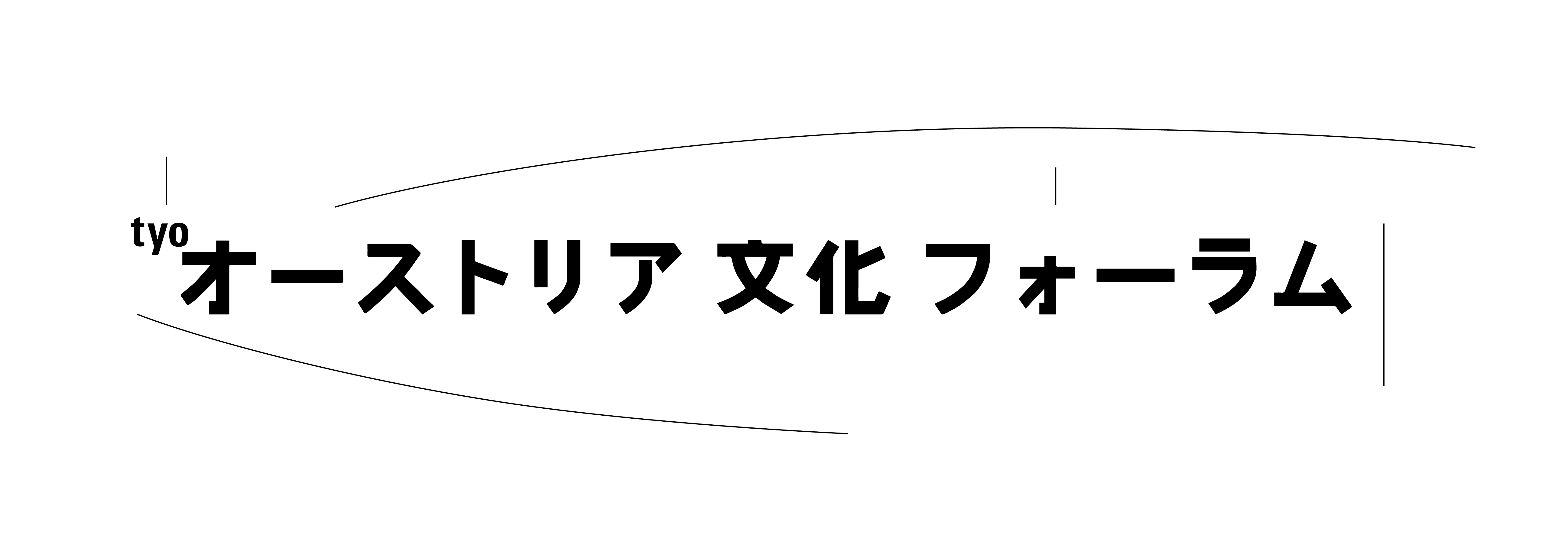Vor dem Fall des Eisernen Vorhangs waren die 1980er Jahre von zwei Diskursen bestimmt: Zum einen vom Wettrüsten der beiden militärischen Blöcke, zum anderen von einer als immer bedrohlicher erscheinenden ökologischen Krise. Als Interpretationsmuster für beide Entwicklungen diente das apokalyptische Denken, freilich nicht mehr im biblischen Sinne, sondern in einer vielfach gebrochenen, säkularisierten Form, gedacht innerhalb der Dispositive der Postmoderne als plurale Enden. Kurz nachdem Christoph Ransmayrs Roman „Die Letzte Welt” (1988) erschienen war, wurden diese Diskurse von den historischen Umwälzungen in Mittel-Osteuropa überlagert. Der Richtungsvektor der Geschichte erschien um 180 Grad gedreht, statt auf ein gewaltsames Ende steuerte die Welt auf eine samtene Revolution zu, durchlebte eine unverhoffte Metamporphose, einen sprunghaften Kulturwechsel. Es erscheint als fruchtbar, den Roman Ransmayrs im Rahmen dieser zeittypischen Diskurse zu untersuchen, wenngleich sein bruchlinienhafter Charakter jeder apodiktischen Einordnung diametral entgegenläuft.